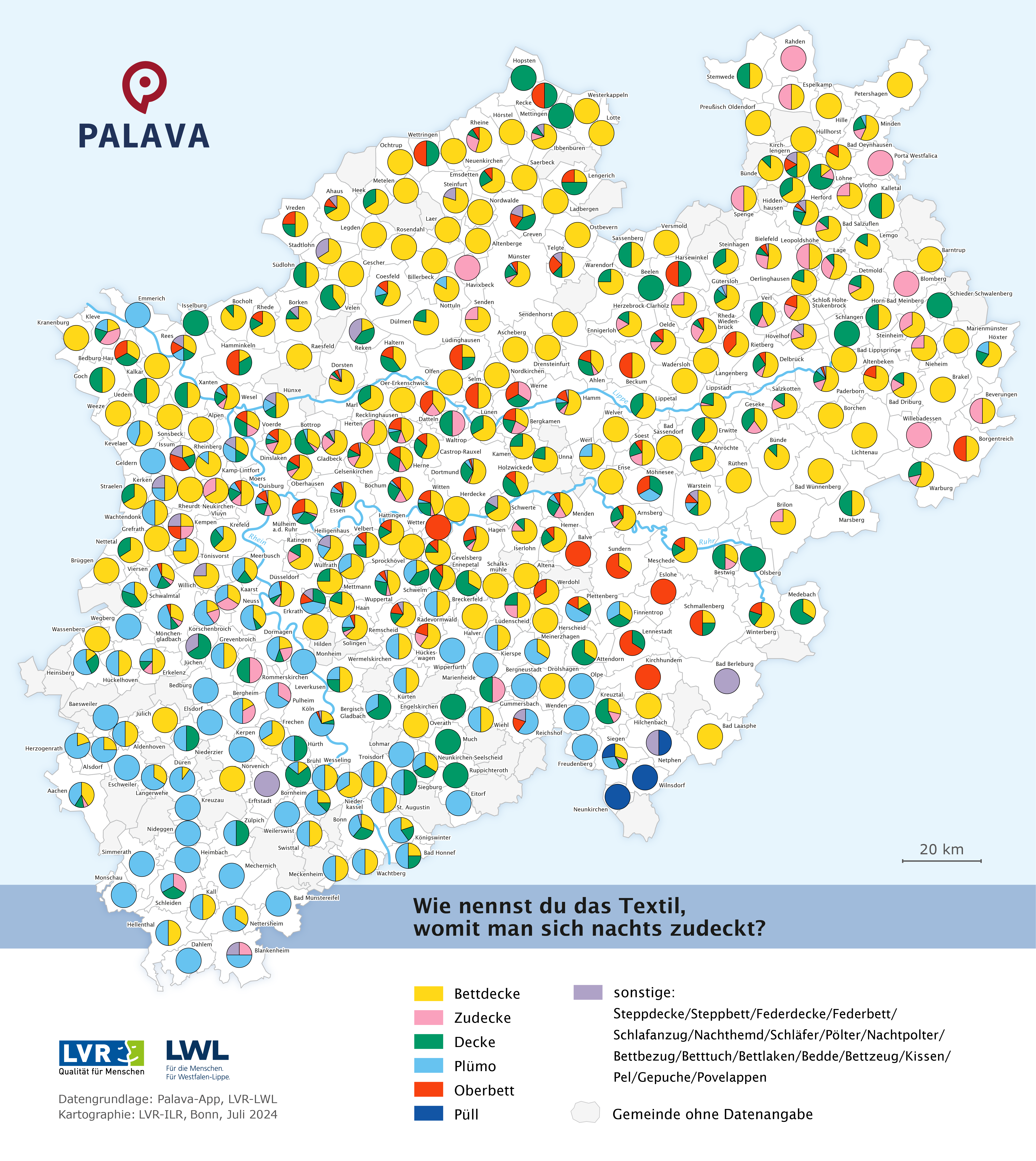Wer freut sich nicht darauf? Das eigene Bett, in das man
sich am Ende eines langen Tages legen und zur Ruhe kommen kann. Was im
besonderen Maße zur Gemütlichkeit – vor allem an kälteren Tagen – beiträgt, ist
das Textil, mit dem man sich nachts zudeckt. Nach genau diesem Textil haben wir
in einer Frage der PALAVA-App gefragt.
Insgesamt konnten 2479 Antworten in die Auswertung mit
einbezogen werden.
Generell ist Bettdecke
mit über 50% aller Nennungen aus ganz Nordrhein-Westfalen der am häufigsten
genannte Begriff – was nicht weiter verwundert, da es sich hier um den standardsprachlichen
Begriff handelt. Am zweitmeisten wurde die verkürzte Variante Decke genannt, die ebenfalls zur Standardsprache
zählt und fast überall vorkommt. Decke
stammt vermutlich – wie auch das Dach
– von der indogermanischen Wurzel *teg-
‚decken‘.
Neben der (Bett-)Decke ist das Plümo ein vielgenutzter Begriff – dieser allerdings nur im
Rheinland. In Westfalen deckt man sich anscheinend so gut wie gar nicht mit dem
Plümo zu. Auffällig war bei der Auswertung dieser Variante, dass manche Nutzer:innen
der App betont haben, ihr Plümo eher im Winter zu nutzen, da es eine dicke bzw.
warme Decke bezeichnet. Dies passt auch gut zur Etymologie des Wortes: Es geht
zurück auf lateinisch pluma ‚Feder‘
und wurde im 19. Jahrhundert aus französisch plumeau ‚Federbett‘ entlehnt. Wenn jemand seine Bettdecke Plümo nennt, meint er/sie also häufig eine
dicke, warme, mit Federn gefüllte Decke. Die deutsche Übersetzung Federbett und ähnliche Varianten wie Federdecke kamen vereinzelt vor, wurden allerdings
aufgrund ihres wenigen Vorkommens unter „sonstige“ gezählt (s. u.).
Das Oberbett wurde
ebenfalls relativ oft genannt. Der Begriff wird laut unseren Daten insbesondere
im Ruhrgebiet zwischen Duisburg und Hamm sowie in Südwestfalen genutzt. In die
Auswertung zu Oberbett wurden zudem ähnlich
klingende Einzelnennungen wie Überbett
dazugezählt.
Die Zudecke wurde
nicht viel seltener als Bezeichnung für das gesuchte Textil gewählt;
insbesondere in Ostwestfalen-Lippe, aber auch in anderen Teilen NRWs wird sich
mit der Zudecke zugedeckt.
Püll ist eine eher
seltene Nennung, allerdings lässt sich auf der Karte deutlich erkennen, dass
der Begriff lediglich im moselfränkischen Zipfel um Siegen herum vorkommt,
zumindest nach den uns zur Verfügung stehenden PALAVA-Daten. Laut dem
Rheinischen Wörterbuch ist Püll ein
Synonym für Oberbett.
Neben diesen aufgeführten Begriffen gibt es natürlich viele
weitere, die aber jeweils weniger als fünf Nennungen umfassen und deshalb unter
„sonstige“ aufgeführt werden. Zum Teil sind dies bekannte Wörter für
Schlafbekleidung wie Schlafanzug oder
auch Pölter und Nachtpolter, die beide ebenfalls Schlafanzug bzw. Nachthemd
bedeuten und auf mittellateinisch paldo
‚Wollenrock‘ zurückzuführen sind. Zum Teil sind es auch Wörter, die andere
Bestandteile auf einem Bett bezeichnen, etwa Kissen oder (Bett-)Bezug. Ob in
diesen Fällen die Fragestellung missverständlich aufgenommen wurde, bleibt
unklar.
Doch nicht nur die räumliche Verteilung ist hier
interessant: Es hat sich herausgestellt, dass sich auch ein Blick in die
verschiedenen Altersgruppen lohnt, denn je nach Geburtsjahr variieren die
Begriffe, die für das Textil genannt werden. Aufgeteilt in vier Altersgruppen
(12-24 Jahre, 25-44 Jahre 45-64 Jahre und 65-89 Jahre) lassen sich einige
Auffälligkeiten feststellen: Decke
wurde von den jungen Nutzer:innen von allen Varianten am meisten genannt; mit
aufsteigendem Alter wird die Decke
stetig weniger genutzt: Bei allen drei weiteren Altersgruppen ist die Standardvariante
Bettdecke deutlich beliebter. Je
jünger die Altersgruppe, desto seltener wurden zudem die Varianten Plümo, Oberbett und Zudecke
genannt. Bei Oberbett ist dies
besonders auffällig: Es wird von der jüngsten Gruppe, von der 93 Antworten
ausgewertet werden konnten, kein Mal genannt. Eine letzte Auffälligkeit, die
ins Auge springt, ist, dass ältere Gewährspersonen augenscheinlich mehr Wörter
für das Textil kennen als jüngere. Während nämlich die 12-24-Jährigen nur vier
Varianten nennen, sind es bei den beiden älteren Gruppen deutlich mehr, zu
sehen unter „Sonstige“. Bei diesen Ergebnissen muss allerdings auch
berücksichtigt werden, dass für die jüngste Gruppe insgesamt die geringste
Anzahl an Antworten vorlagen – die ausgewerteten Antworten für die
25-44-Jährigen und die 65-89-Jährigen lagen im 500- bzw. 600-stelligen Bereich.
Für die zweitälteste Gruppe lagen mit über 1300 die mit Abstand meisten
ausgewerteten Antworten vor.
Literatur:
Peter Honnen: Wo kommt dat her?
Herkunftswörterbuch der Umgangssprache an Rhein und Ruhr. Köln 2018.
Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.
Bearbeitet von Elmar Seebold. 25., durchgesehene und erweiterte Auflage.
Berlin/Boston 2011.
RhWB = Rheinisches Wörterbuch. […] hrsg. und bearb. von
Josef Müller u. a. Bonn, Berlin 1928—1971. [URL:
https://www.woerterbuchnetz.de/RhWB].