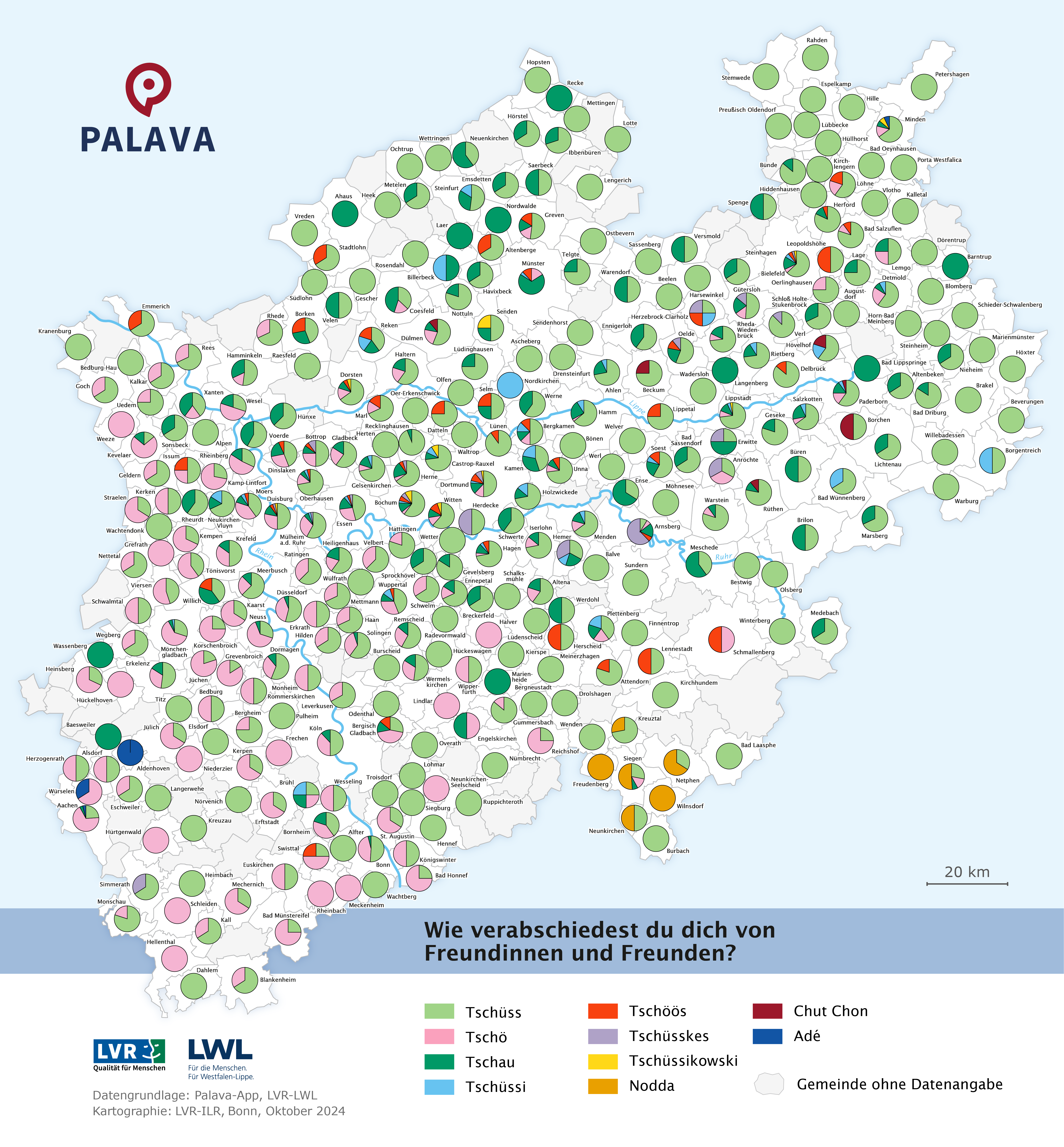In Nordrhein-Westfalen haben sich
über die Jahre hinweg zahlreiche Abschiedsfloskeln entwickelt. Im Folgenden
wird die regionale Verteilung betrachtet, bevor die Herkunft der Begriffe
erläutert wird.
Tschüss ist mit 1647 Nennungen die mit
Abstand am häufigsten genannte Variante und in ganz NRW verbreitet. Die
alternative Form Tschüssi ist ebenfalls nicht regional begrenzt und
landesweit genannt worden (74 Nennungen). Auch Tschüssikowski fiel in
der Befragung einige Male, die Variante ist hauptsächlich im Ruhrgebiet
verbreitet (17 Nennungen).
Mit 561 Nennungen ist die Variante Tschö
am zweithäufigsten genannt worden. Diese Variante wurde nahezu ausschließlich
im Rheinland verwendet. Darunter fallen bspw. Tschö mit ö oder Tschökes. Gelegentlich wird sich auch mit Tschö, wa verabschiedet (z.B. in Aachen).
Die dritthäufigste Variante,
Tschau (370 Nennungen), wird vorrangig im
Norden von NRW verwendet, ist aber auch in anderen Regionen des Landes zu hören. Auch großräumig verteilt, aber
vor allem in Westfalen genutzt, ist die Variante Tschööss (72
Nennungen). Die niederdeutsche Variante Tschüsskes/Tschüssken (52
Nennungen) findet sich nördlich der Benrather Linie. Ein adé ist heute
zumindest noch im Aachener Raum zu hören (11 Nennungen), auch genannt wurde
dort adiëda.
Die regionalen Abschiedsfloskeln sind
durch vielfältige kulturelle Einflüsse geprägt. Spanische und französische Entlehnungen wie „adiós“ und „adieu“ wurden im Rheinland dialektal
angepasst und verkürzt. Tschüss geht so zurück auf adschüss und
das, so wird angenommen, leitet sich vom spanischen adiós ab, das über
eine Reihe von Sprachwandelprozessen im niederdeutschen Raum adaptiert wurde
(vgl. Möller 2003: 333). Davon ausgehend kann angenommen werden, dass es sich
bei Tschö nicht um eine abgewandelte Kurzform von Tschüss
handelt, sondern stattdessen eine davon unabhängige Kurzform zu franz. adieu
(vgl. Kluge 1953: 7). Die Form Adschö, die ebenfalls genannt wurde, stellt
eine dialektal angepasste Variante von adieu dar, die vor allem im Rheinland
verbreitet war. Diese Form hat sich über die Jahre zu dem heute häufig
verwendeten Tschö entwickelt. Der Gruß Tschau kam hingegen erst später
auf, wohl im Zuge des wachsenden kulturellen Austauschs mit Italien und wurde
dann ebenfalls vereinzelt übernommen (vgl. Möller 2003: 333). Alle drei Grüße
sind auf lat. ad deum (dt. ‚zu Gott‘) zurückzuführen.
Auch genannt wurden bspw. Auf
Wiedersehen sowie verschiedene Formen von Mach’s gut. Beide sind aufgrund ihrer
überregionalen Verbreitung (im gesamten mitteldeutschen Sprachraum, vgl. AdA)
nicht auf der Karte aufgeführt. In unserer Befragung wurden auch zwei
spezifische dialektale Formen genannt, die ähnliche Bedeutungen wie diese
gängigen Abschiedsfloskeln haben: Im Siegerland fiel der Begriff Nodda
(16 Nennungen). Nodda ist im Siegerländer Platt der Ausdruck für ‚Auf
Wiedersehen‘. Ein anderer dialektaler Begriff fiel in verschiedenen Orten
Westfalens: Guet gaohn, gesprochen
„chut chon“ (16 Nennungen) ist die Kurzform von „Laot juh guet
gaohn“ (‚Lass‘ es dir gut gehen‘) (vgl. NDR).
Literatur
AdA = Elspaß,
Stephan/Möller, Robert (2003ff): Atlas zur deutschen Alltagssprache (AdA). https://www.atlas-alltagssprache.de/r10-f17ab/
(Stand 06.11.2024).
Kluge (1953):
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, bearb. v. Alfred Götze, 16.
Aufl. Berlin u.a.
Möller, Robert (2003): Das rheinische „tschö“. In: Rheinische Vierteljahrsblätter
(65), S. 333-339.
NDR = NDR Kultur:
Plattdeutsches Wörterbuch. (Stand 06.11.2024).