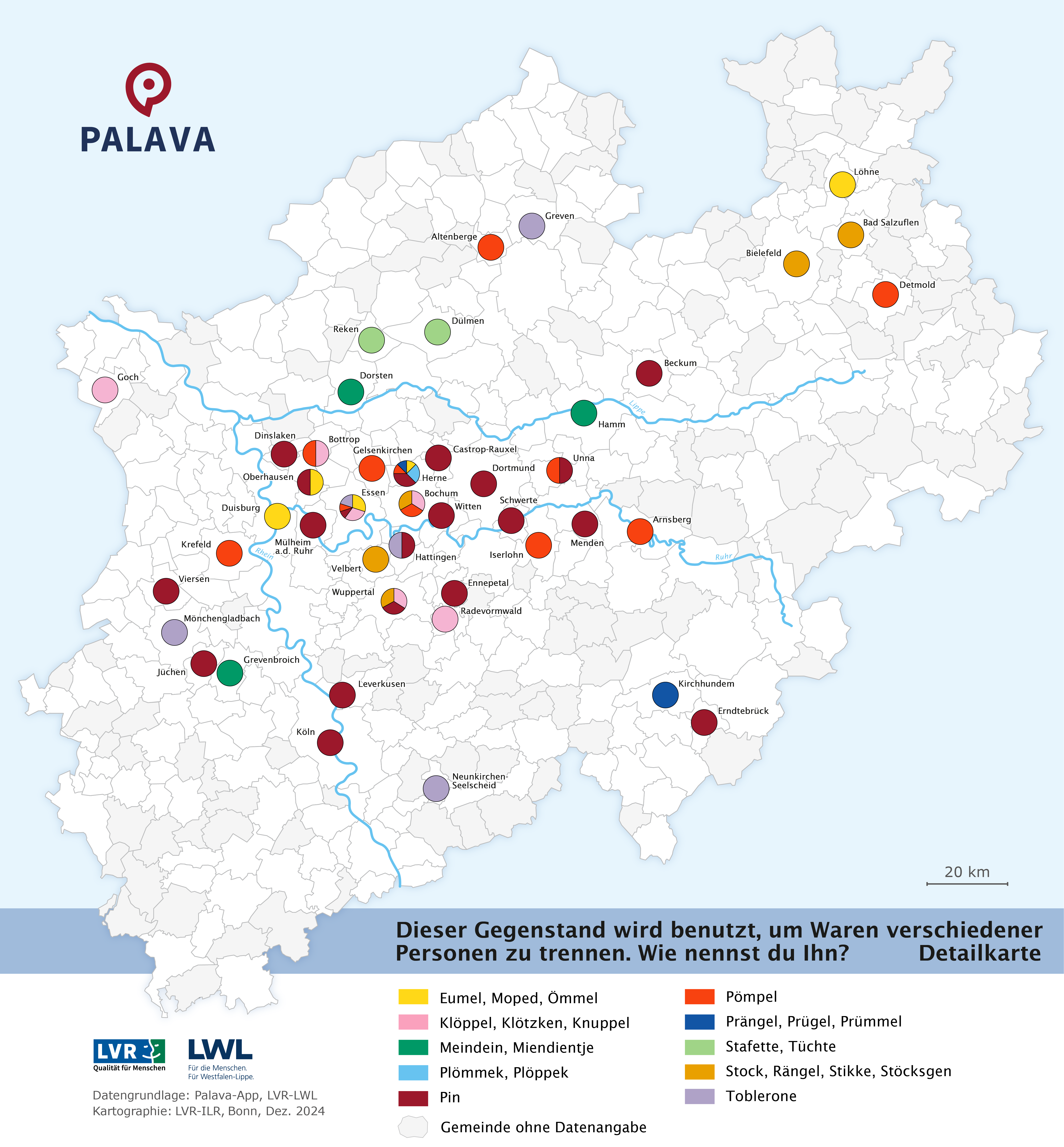Zu den standardsprachlichen Formen gibts eine eigene Karte (auf der Blogseite runterscrollen)!
Für die Wörter aus den
Mundarten zeigt sich trotz allgemein geringerer Frequenz eine ebenso große
Vielfalt. Wörter wie Stöcksgen und Hölzken beziehen zunächst nur ihr
Diminutivsuffix aus dem Niederdeutschen. Genuin niederdeutsche Wörter wie Pin inklusive seiner Abwandlungen wie Pinöckel, Pinötzel, Pinurek, Pinöppel oder einfach nur Nöppel stehen hier neben Rängel und Stikke. Sie bezeichnen jeweils einen Stock oder allgemein
länglichen Gegenstand, werden aber gemessen an der Gesamtzahl niederfrequent
genannt (1,25% aller Antworten). Daneben sind sie in den rheinischen und
westfälischen Regiolekt übergegangen wie auch Teil des Ruhrdeutschen als einer
Kombination aus beiden Regiolekten mit dialektalem Substrat. Selbiges gilt für Eumel, Ömmel, Pömpel, Prängel und Prügel. Gerade bei letzteren beiden Worten fällt zudem die vulgäre
Konnotation auf.
Eumel und Ömmel können wiederum als
Universalwörter zur Bezeichnung vieler Gegenstände gelten, weswegen hierunter
auch der Begriff Moped fällt, für den
semantisch dasselbe gilt. Plömmek und
Plöppek als Ableitungen treten wie
die vorgenannten fünf Begriffe in einem Streifen von Ostwestfalen übers
Ruhrgebiet bis zum Niederrhein auf. Das Suffix {-ek}, wie schon in Pinurek, ist im Ruhrdeutschen als
Ableitung aus dem Polnischen generalisiert. Während nur das Wort Mottek im Vokabular verblieb, ist das
abgeleitete Suffix weiterhin produktiv, wie neben Pillek für Pils oder Spillek
für Spielplatz o.g. Beispiele zeigen. Dieses können als (onomatopoetische)
Varianten von „plump“ gelten, was „unförmige Form aufweisend“ bedeutet, in
letzterer Variante mit dem Geräusch „Plopp“ als Wortstamm.
Regiolektale und
niederdeutsche Bezeichnungen fallen durch ihre Kürze auf. Während die
hochdeutschen Komposita zu Komplexität tendieren und sich in ihrer Wortbildung
am Zweck des Gegenstandes orientieren, bedienen sich die dialektalen und
regiolektalen Begriffe eines einzelnen Merkmals, am häufigsten der Form, um den
Warentrenner zu benennen, genauso wie die Toblerone.
Ausnahmen wie Meindein/Miendientje, welchen der Zweck der
Einteilung in „meinen“ und „deinen“ Einkauf zugrunde liegt, bestätigen diese
Regel.
Literatur:
Blind, Sofia: Wörter, die
es nicht auf Hochdeutsch gibt. Von Anscheuseln bis Zurückdummen. Köln: DuMont
2019.
Duden. Die deutsche
Rechtschreibung. Hrsg. von der Dudenredaktion. 29. Aufl. Berlin: Dudenverlag
2024 (= Duden Band 1).
Honnen, Peter: Wo kommt
dat her? Herkunftswörterbuch der Umgangssprache an Rhein und Ruhr. Köln: Greven
Verlag 2018.
Langenscheidt Lilliput.
Ruhrpott-Deutsch. Hrsg. von der Langenscheidt-Redaktion. München: Langenscheidt
2017.
Wörterbuchnetz:
Westfälisches Wörterbuch. https://woerterbuchnetz.de/?sigle=WWB&lemid=A00001
(13.11.2024).