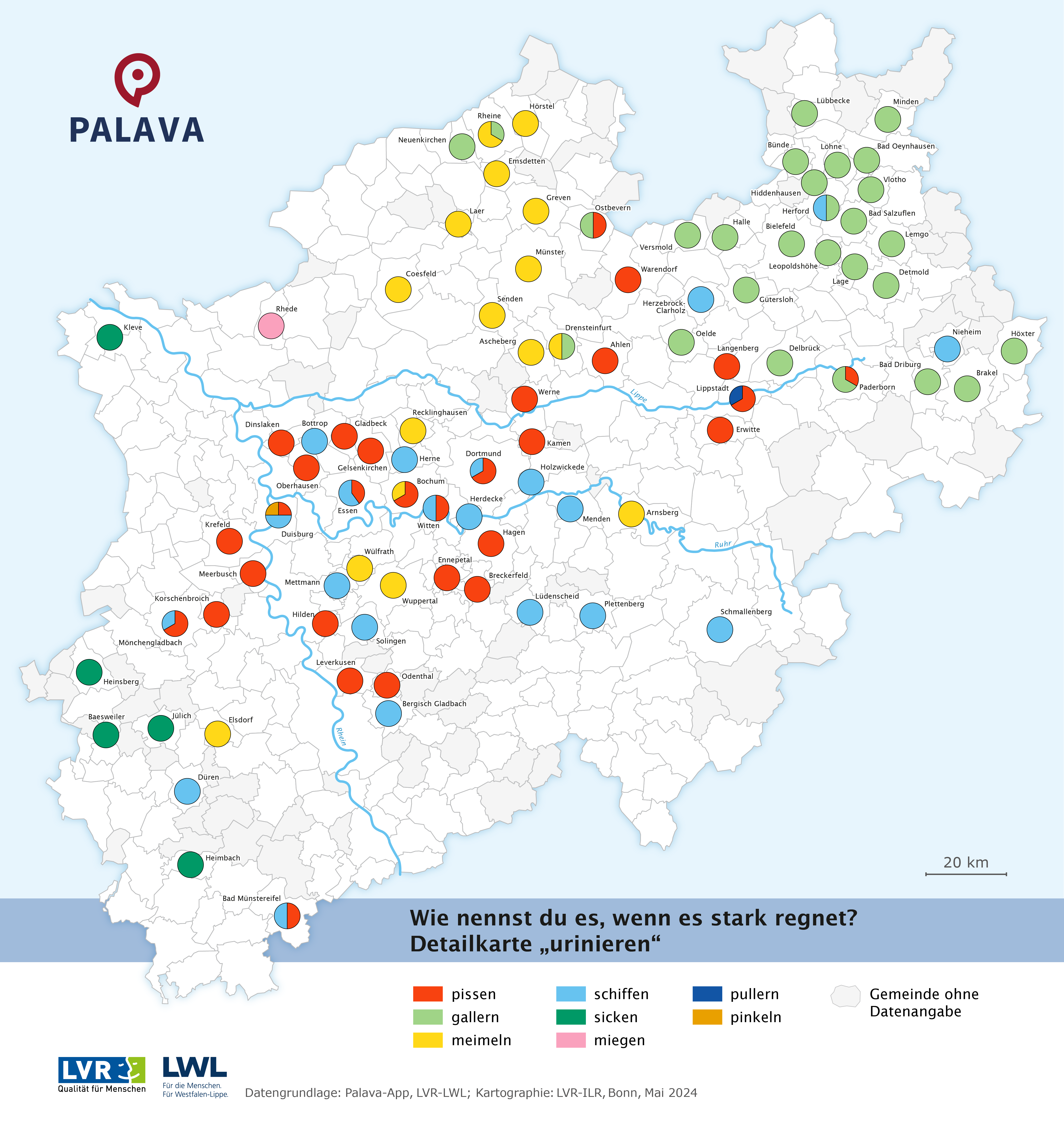Die Sprachkarte mit den Antworten auf die Frage „Wie nennst
du es, wenn es stark regnet?“ hat eine große Vielfalt hinsichtlich der
verwendeten Verben aufgezeigt. Dabei war besonders auffällig, dass einige
dieser Verben (insgesamt acht) neben der Bedeutung ‚stark regnen‘ eine weitere
Gemeinsamkeit haben: Sie bedeuteten ursprünglich bzw. bedeuten auch ‚urinieren‘.
Die regionale Verbreitung dieser Wörter wird nun auf der hier präsentierten
Detailkarte dargestellt; insgesamt handelt es sich um 127 Nennungen.
Im Süden NRWs (und mit einer Ausnahme auch am Niederrhein)
wird das Wort sicken genannt. Es geht
auf althochdeutsch sihan ‚leise
tröpfeln‘ zurück, woraus im Mittelhochdeutschen seichen und im Mittelniederdeutschen seken ‚urinieren‘ entstanden ist. Ein weiteres Verbreitungsgebiet
hat die Variante pissen, die in
unseren Antworten im Bergischen Land, am Niederrhein, im Ruhrgebiet und
vereinzelt im Süden des Münsterlands und von Ostwestfalen-Lippe genannt wird.
Das Wort geht auf altfranzösisch pissier
zurück und wurde bereits im Mittelalter in den deutschen, den niederländischen
und auch den englischen Sprachraum entlehnt (vgl. Honnen 2018, S. 416, DWDS). Im
Ruhrgebiet, im Bergischen Land und im Sauerland findet sich die Variante schiffen. Dieses Wort hat die Bedeutung
‚urinieren‘ auf einigen Umwegen erhalten. Althochdeutsch skif, skef bedeutete neben ‚Wasserfahrzeug‘ auch ‚Gefäß‘ und diese
zweite Bedeutung blieb in einigen deutschen Dialekten erhalten. Im 18.
Jahrhundert entwickelte sich daraus in der Studentensprache die Bezeichnung Schiff für den Nachttopf und davon
abgeleitet das Verb schiffen für
‚Wasser lassen‘ (vgl. Honnen 2018, S. 495f., DWDS). Einmalig belegt in unseren
Daten ist pinkeln in der Bedeutung
‚stark regnen‘ (Duisburg). Die genaue Herkunft des Wortes ist nicht geklärt, es
wird eine Verwandtschaft zu pissen
und daraus entstandenem Pipi machen
angenommen (vgl. DWDS, DUDEN). Ebenfalls nur einmal wird das Wort miegen genannt (Rhede). Hierbei handelt
es sich um ein niederdeutsches Dialektwort. Dieses wird abgesehen der
kartierten Bedeutung vor allem im Zusammenhang mit einem kleinen Insekt
verwendet: der Ameise oder regionial z.B. Migamp
(vgl. RhWb, Bd.5 Sp.1131). Viele Arten sondern nämlich säurehaltigen Urin ab,
um sich zu verteidigen (vgl. WWb Bd.4, Sp. 152) Schwerpunktmäßig im Münsterland
begegnet das Wort meimeln, das aus
der Münsteraner Sondersprache Masematte stammt und aus dem Jiddischen entlehnt
wurde. Im Jiddischen hat es sowohl die Bedeutung regnen als auch urinieren,
wobei bei der Entlehnung für das Gebiet um Münster nur regnen eine Rolle
spielte (vgl. Stern 2000, S. 125). Aus Lippstadt wird einmal das Wort pullern gemeldet. Hierbei handelt es
sich um eine regionale Variante für ‚urinieren‘, die in erster Linie im
Nordosten und Osten Deutschlands gebräuchlich ist. Die Verwendung in der
Bedeutung ‚stark regnen‘ ist wohl eher selten (DWDS, DUDEN). In Ostwestfalen
wird vergleichsweise häufig das Dialektwort gallern
genannt.
Literatur:
DUDEN = DUDEN. Digitales Wörterbuch, hrsg. v. d.
Dudenredaktion. [https://www.duden.de/woerterbuch].
DWDS = DWDS. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Das
Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart, hrsg. v.
d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. [URL: https://www.dwds.de/].
Peter Honnen: Wo
kommt dat her? Herkunftswörterbuch der Umgangssprache an Rhein und Ruhr. Köln
2018.
RhWB = Rheinisches Wörterbuch. […] hrsg. und bearb. von
Josef Müller u. a. Bonn, Berlin 1928—1971. [URL: https://www.woerterbuchnetz.de/RhWB].
Sievert, Klaus: Wörterbuch deutscher Geheimsprachen. Berlin
u.a. 2023.
Stern, Heidi: Wörterbuch zum jiddischen Lehnwortschatz in
den deutschen Dialekten. Tübingen 2000.
WWb = Westfälisches Wörterbuch. hrsg. von der Kommission für
Mundart- und Namenforschung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.
Kiel/Hamburg 1969–2021. [URL: https://www.woerterbuchnetz.de/WWB].